„Jesus braucht keine Verehrer, sondern Nachfolger“
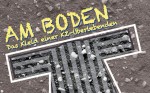 Viel Anteilnahme und auch Tränen: Mitglieder der Katholischen Studierenden Jugend (KSJ) haben im Rahmen der heute endenden Heilig-Rock-Wallfahrt das Häftlingsgewand einer Überlebenden des KZ Ravensbrück ausgestellt. Eingerahmt von einer ergreifenden Ausstellung mit Tagebuchausschnitten anderer KZ-Gefangener, Informationen zur Geschichte des Kleides und künstlerischen Beiträgen stellte das historische Kleidungsstück eine gelungene Ergänzung zur Präsentation des Tunika Christi dar. „Wir hatten KZ-Überlebende und Angehörige von KZ-Opfern hier, die am Kleid getrauert haben“, erzählt Pastoralreferentin Jutta Lehnert. Rund 4.000 Besucher, darunter Pilger, Schulklassen und viele Zeitzeugen kamen, um das Relikt der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft zu sehen.
Viel Anteilnahme und auch Tränen: Mitglieder der Katholischen Studierenden Jugend (KSJ) haben im Rahmen der heute endenden Heilig-Rock-Wallfahrt das Häftlingsgewand einer Überlebenden des KZ Ravensbrück ausgestellt. Eingerahmt von einer ergreifenden Ausstellung mit Tagebuchausschnitten anderer KZ-Gefangener, Informationen zur Geschichte des Kleides und künstlerischen Beiträgen stellte das historische Kleidungsstück eine gelungene Ergänzung zur Präsentation des Tunika Christi dar. „Wir hatten KZ-Überlebende und Angehörige von KZ-Opfern hier, die am Kleid getrauert haben“, erzählt Pastoralreferentin Jutta Lehnert. Rund 4.000 Besucher, darunter Pilger, Schulklassen und viele Zeitzeugen kamen, um das Relikt der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft zu sehen.
TRIER. Im Dachgeschoss des KSJ Diözesanbüros in der Weberbach betreten die Besucher zunächst einen Raum mit Stellwänden, die über die Hintergründe des Kleidungsstückes aufklären. Die harten Fakten und Informationen werden ergänzt durch künstlerische Beiträge der 17-jährigen Alwine Baresch, die das Thema auf eindrucksvolle Art und Weise interpretiert. Das eigentliche Kleid der ehemaligen politischen Gefangenen Zofia Klinke befindet sich in einem „Raum der Stille“. Es liegt umgeben von einem Kreis aus Stühlen, Hockern und Sitzkissen auf grauem Kies ausgebreitet auf dem Boden. Der rauhe, schwarz-grau gestreifte Stoff ist an beiden Armen löchrig. Unter einem roten Aufnäher mit dem Buchstaben „P“ auf Höhe des linken Oberarmes erkennt man die Häftlingsnummer 25948. Ziffern, die der Gefangenen jegliche Identität raubten und ihrer Individualität jede Bedeutung nahmen. Man erkenne es sofort am Gesichtsausdruck eines Besuchers, wenn er aus dem Raum herauskommt, so Jutta Lehnert.
Die Geschichte des Kleides ist ebenso erschütternd wie beeindruckend. Die Polin Zofia Klinke wurde im Alter von 25 Jahren von den Nationalsozialisten in das Konzentrationslager Ravensbrück deportiert. In unterirdischen Fabrikationshallen musste sie als Zwangsarbeiterin Steuerungs- und Zündteile für Flugbomben anfertigen. Bomben, die auch dazu bestimmt waren, ihr Land zu zerstören. Die Schmerzen und Qualen, die sie erleiden musste, haben auf dem gestreiften Kleid ihre Spuren hinterlassen. Während der gesamten Gefangenschaft trug sie das kratzende Gewand und kehrte darin nach Kriegsende in ihr Heimatland zurück. 2002, fast 60 Jahre später, übergab sie das Kleid im Rahmen von Versöhnungsgesprächen an das Maximilian-Kolbe-Werk. Fünf Jahre später starb Klinke, hinterließ mit ihrem Kleid aber einen stillen Zeugen, der, stellvertretend für Millionen geächteter, verfolgter und ermordeter Menschen, an das Schicksal der Opfer des Dritten Reichs erinnert.
„Wörter wie Demütigung, Erniedrigung und Angst fallen immer“
 Doch „das Kleid erzählt zwei Geschichten“, erklärt die Mitwirkende Sandra Fait: „einmal die der Versklavung und Folter, aber auch die der Versöhnung und Verarbeitung“. Besonders viele ältere Menschen seien nach der Ausstellung sehr bedrückt gewesen, hat die 25-jährige Studentin beobachtet. „Es ist nochmal eine Vertiefung der Eindrücke, die mich mein Leben lang begleitet haben“, meint eine ältere Dame, deren Kindheit durch den Zweiten Weltkrieg geprägt war, sichtlich ergriffen. Auf der Feedback-Pinnwand finden sich nur Worte wie „berührend“, „überwältigend“ oder „beeindruckend“.
Doch „das Kleid erzählt zwei Geschichten“, erklärt die Mitwirkende Sandra Fait: „einmal die der Versklavung und Folter, aber auch die der Versöhnung und Verarbeitung“. Besonders viele ältere Menschen seien nach der Ausstellung sehr bedrückt gewesen, hat die 25-jährige Studentin beobachtet. „Es ist nochmal eine Vertiefung der Eindrücke, die mich mein Leben lang begleitet haben“, meint eine ältere Dame, deren Kindheit durch den Zweiten Weltkrieg geprägt war, sichtlich ergriffen. Auf der Feedback-Pinnwand finden sich nur Worte wie „berührend“, „überwältigend“ oder „beeindruckend“.
Besonders die Reaktion von Kindern sei sehr erstaunlich, so Fait. „Sie stellen viele Fragen und man merkt, wie sehr sie das beschäftigt“. Wenn Schulklassen in die Ausstellung kommen, setzen sich die Betreuer mit den Schülern zusammen und sprechen über die Gefühlsregungen, die das Gewand bei ihnen auslöst. „Wörter wie Demütigung, Erniedrigung und Angst fallen immer“, erzählt Jutta Lehnert.
Viele Pilger hätten die Ausstellung als eine Vorbereitung und Vertiefung zum Heiligen Rock gesehen. Tatsächlich sind Parallelen bereits auf den ersten Blick erkennbar. Beide Gewänder erzählen von Leid und Unrecht, senden aber auch jeweils eine positive Botschaft an die Welt. Im Gegensatz zum Leibrock Christi wird das Häftlingskleid von Zofia Klinke zwar nicht verehrt. Dennoch erreicht es die Menschen und wirkt mahnend auf seine Besucher. Eine Wirkung, die sich vermutlich nachhaltiger im Gedächtnis des Besuchers niederschlägt als die Betrachtung einer Reliquie, deren Bedeutung berechtigterweise historisch angezweifelt wird. Eine Wirkung, die so manchen Pilger hat sagen lassen: „Das ist der eigentliche heilige Rock“. Dennoch stellt Jutta Lehnert klar: „Wir sind keine Kritik am Heiligen Rock, aber wir sagen: Jesus braucht keine Verehrer, sondern Nachfolger“.
Simon Neumann
von 16vor
